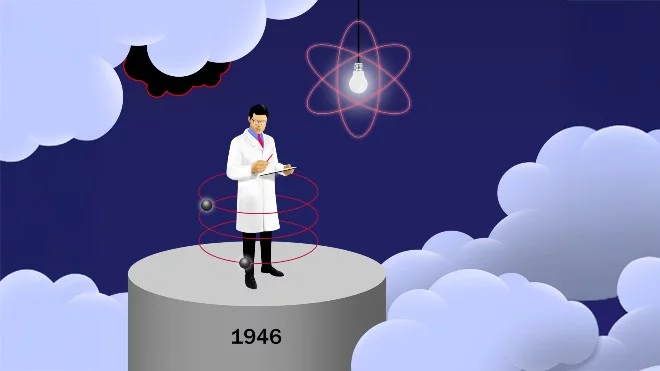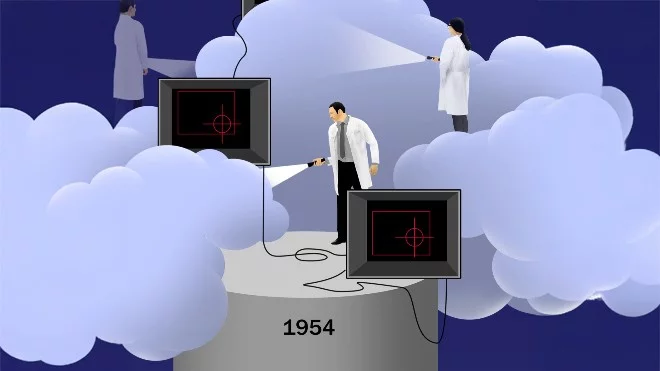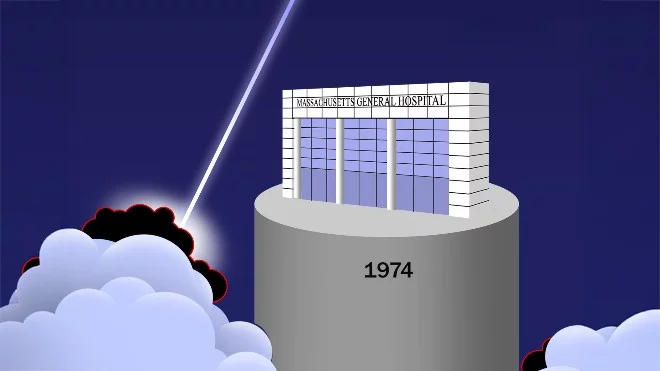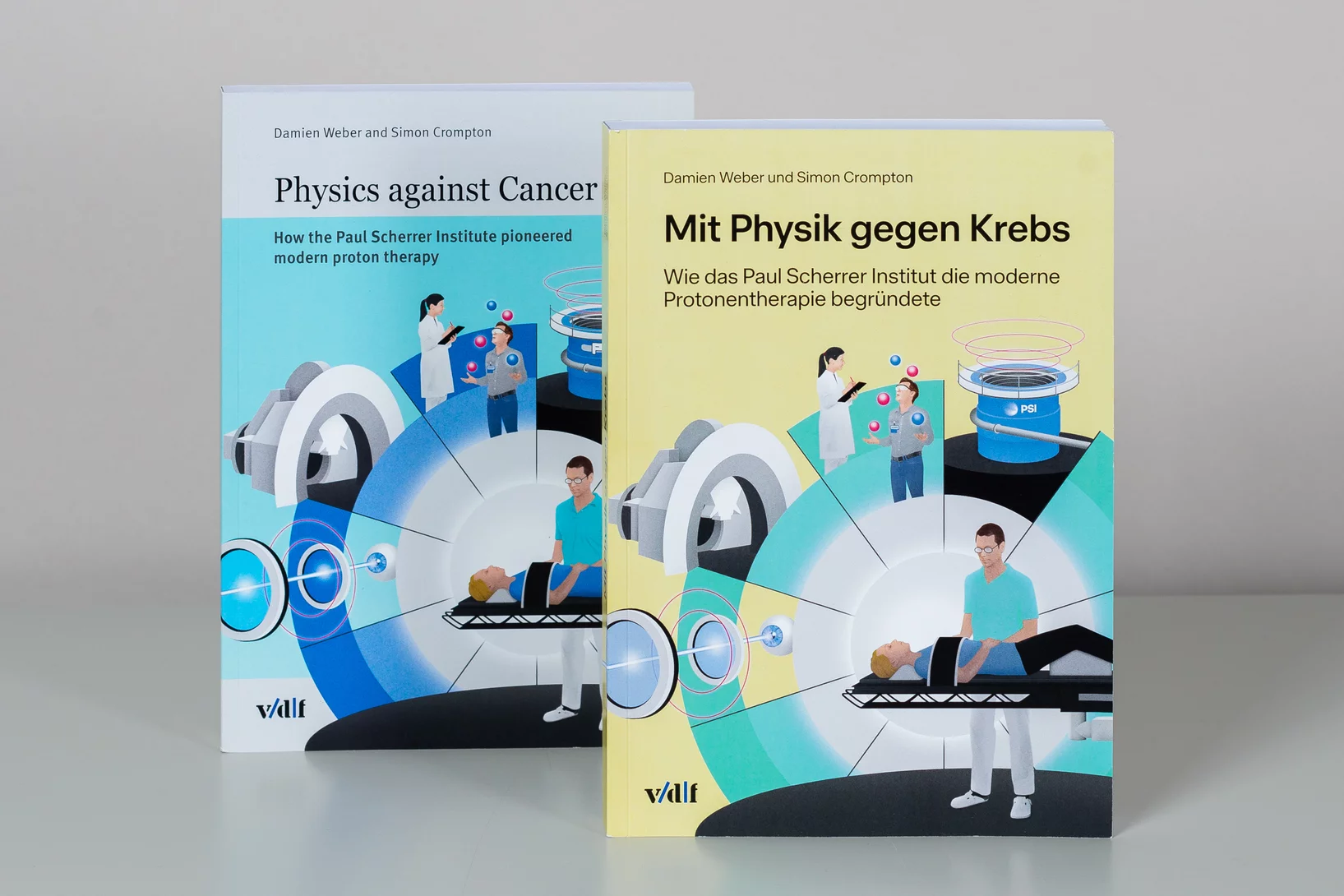Mit Hightech gegen Krebs
Am Zentrum für Protonentherapie werden Patientinnen und Patienten mit einem am PSI entwickelten Verfahren schonend und effizient behandelt: Die Protonentherapie nutzt die Energie von Protonen, um Tumorzellen zu zerstören.
Was sind Protonen?
Protonen gehören zu den Bausteinen der Atome. Die gesamte uns umgebende Materie setzt sich aus Atomen zusammen. Deren Kerne bestehen aus verschiedenen Anzahlen von positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Der Atomkern ist umgeben von einer Atomhülle aus negativ geladenen Elektronen. Wie alle geladenen Teilchen können Protonen in Magnetfeldern abgelenkt, gebündelt und zu einem Strahl geformt werden.
Eine kurze Zeitreise:
Über 70 Jahre sind vergangen seit der ersten Idee bis zu ihrer heutigen erfolgreichen Umsetzung. Jahrzehntelange Forschung sowie ausgeklügelte technologische Entwicklungen machten das Zentrum für Protonentherapie ZPT des PSI zu einem der weltweit wichtigsten Behandlungs- und Forschungszentren für die gezielte Behandlung von Tumoren mit Protonen.
1946
Der Amerikaner Robert R. Wilson ist erschüttert von der Wirkung der Atombombe, an deren Entwicklung er beteiligt war, und setzt sich nun für eine friedliche Nutzung nuklearer Energie ein. So schlägt er als erster Wissenschaftler eine Tumortherapie mit geladenen Teilchen, insbesondere mit Protonen, vor.
Bragg-Peak
Wilsons Vorschlag basiert auf den Erkenntnissen von William Henry Bragg rund 40 Jahre zuvor. Bragg hatte bewiesen, dass Protonen bei ihrem Weg durch Materie ihre maximale Energie erst unmittelbar vor ihrem Stillstand abgeben. Anders als Photonen und damit Röntgenstrahlen können sie die höchste Strahlendosis also direkt im Tumor deponieren und das davorliegende gesunde Gewebe wird kaum belastet, das dahinter liegende gar nicht.
1954
Einige Jahre später starten in den Vereinigten Staaten erste klinische Studien zur therapeutischen Anwendung der Teilchenstrahlung. Allerdings werden erst einmal hormonaktive Tumore der Hirnanhangdrüse behandelt, da sich die diagnostische Bildgebung noch in ihrem Anfangsstadium befindet und andere Tumore mit den damaligen Methoden nicht präzise genug lokalisiert werden können.
1970er
Die Entwicklung der diagnostischen Bildgebung, wie das Aufkommen der Computertomografie, sowie der Fortschritt der durch Computer unterstützten Radiotherapie ermöglichen erste Behandlungen von bösartigen Tumoren mittels Teilchenbestrahlung.
1974
1974 wird im Massachusetts General Hospital (Boston, USA) zum ersten Mal ein bösartiger Tumor eines Patienten mit der Protonentherapie behandelt.
1980
Ein bereits 1974 am PSI in Betrieb genommener Protonenbeschleuniger ermöglicht es einem Team von engagierten Medizinern, Physikern und Technikern, eine präzise Methode der Behandlung von Tumoren mit Protonen zu entwickeln.
Forschungsinstitute
Protonentherapiezentren gehen in der Regel aus Forschungsinstituten hervor. Denn um eine so hochkomplexe Methode zu realisieren, braucht es Wissen und Erfahrung aus der Grundlagenforschung sowie eine dazu passende grosse Forschungsinfrastruktur, wie sie am PSI und vergleichbaren Forschungseinrichtungen vorhanden ist.
1984
Seit 1984 wird die Protonentherapie am PSI zur Behandlung von Patientinnen und Patienten eingesetzt, die an einem Augentumor erkrankt sind. Dafür steht die Therapieanlage OPTIS zur Verfügung.
1996
Am PSI wird die Gantry 1 in Betrieb genommen. Es ist weltweit die erste Anlage, an der Patientinnen und Patienten im klinischen Routinebetrieb mit dem am PSI entwickelten Spot-Scanning-Verfahren behandelt werden. Mit dieser Behandlungstechnik lässt sich der Protonenstrahl so steuern, dass sich der Punkt (Spot), an dem die Protonen ihre höchste Energiedosis abgeben, genau am gewünschten Ort im Tumor befindet. Durch Überlagern vieler einzelner Spots wird der Tumor gleichmässig mit der erforderlichen Strahlendosis belegt. Das erlaubt eine äusserst präzise, homogene Bestrahlung, die an die meist unregelmässige Form des Tumors optimal angepasst ist. Ein Synonym für Spot-Scanning ist Pencil-Beam-Scanning, weil der Strahl etwa so dünn ist wie ein Bleistift.
1998
Die Erfolge der Augentherapie und das internationale Interesse an der Spot-Scanning-Technik veranlasst das PSI, Strategien zur Weiterentwicklung der Protonentherapie zu erarbeiten. Es wird beschlossen, die Forschung und Entwicklung zu verstärken und die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit der Protonentherapie am PSI weiter auszubauen.
2007
Die Protonentherapie am PSI erhält einen eigenen Ringbeschleuniger. Bis anhin kamen die Protonen vom grossen Protonenbeschleuniger des PSI. Dieser dient jedoch primär Forschungszwecken und befindet sich jedes Jahr für mehrere Wochen in der Revision. Mit dem neuen kompakten und supraleitenden Beschleuniger können Patientinnen und Patienten das ganze Jahr über behandelt werden.
2013
Die Weiterentwicklung der ersten Gantry führt zu einer neuen Bestrahlungsanlage, der Gantry 2, die mit erweiterten Bestrahlungsoptionen ausgestattet ist. Im November 2013 wird der erste Patient an der Gantry 2 bestrahlt.
2018
Die Gantry 3, ein weiterer hochmoderner Behandlungsplatz, geht in Betrieb. Sie wurde in einer Forschungszusammenarbeit mit einem kommerziellen Anbieter realisiert. Technisch bietet die Gantry 3 vergleichbare Behandlungsmöglichkeiten an wie die Gantry 2.
Ende 2018 wird der Patientenbetrieb an der Gantry 1 eingestellt. An dieser Gantry wurden über 1300 Patientinnen und Patienten erfolgreich behandelt. Die Gantry 1 ist für Forschungszwecke weiterhin im Einsatz.
Funktionsweise der Gantry
An den Behandlungsplätzen des Zentrums für Protonentherapie am PSI können Tumore aus jeder Richtung bestrahlt werden. Dazu kann der Bestrahlungskopf der Gantry um den Patienten herumgedreht werden. Eine Gantry ist über 200 Tonnen schwer; eine Vielzahl von Magneten lenkt den Protonenstrahl präzise auf die richtige Stelle.
Protonenbeschleunigung
Ihren Ursprung nehmen die Protonen an der Ionenquelle, die im Ringbeschleuniger sitzt. In ihr werden kontinuierlich Wasserstoffatome in Elektronen und Protonen zerlegt. Nachdem die Protonen 630 Mal eine Kreisbahn durchlaufen haben, werden sie in den Strahlengang geleitet und dort mithilfe von Magneten gebündelt. Mit zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit fliegen die Protonen dann durch den ungefähr 50 Meter langen Strahlengang zu einem der Behandlungsplätze und werden gezielt auf den Tumor gelenkt.
Heute
Die vom PSI entwickelte Spot-Scanning-Technik hat sich weltweit als führende Technologie in der Protonentherapie durchgesetzt. Am PSI wird sie ständig weiterentwickelt. Das Ziel ist, die Geschwindigkeit der Behandlung zu erhöhen und gleichzeitig die Präzision noch weiter zu verbessern. Die enge Verbindung von technischer Entwicklung und klinischem Betrieb zeichnet das PSI gegenüber einem Spital oder einem industriellen Hersteller aus. Auf der klinischen Seite beteiligt sich das PSI an internationalen Studien. Ziel ist, das Behandlungsspektrum zu erweitern, damit auch Krebspatienteninnen und -patienten mit bisher in der Schweiz nicht zugelassenen Indikationen von den Vorteilen der Protonentherapie profitieren können.
Weltweit wächst die Zahl der mit einer Spot-Scanning-Protonentherapie ausgestatteten Zentren stetig weiter. Sie wird sich nach derzeitigem Stand von rund 90 im Jahr 2020 bis ins Jahr 2030 sogar verdoppeln. So kommt auf der ganzen Welt immer mehr Patientinnen und Patienten diese besonders präzise und schonende Bestrahlungstechnik zugute.