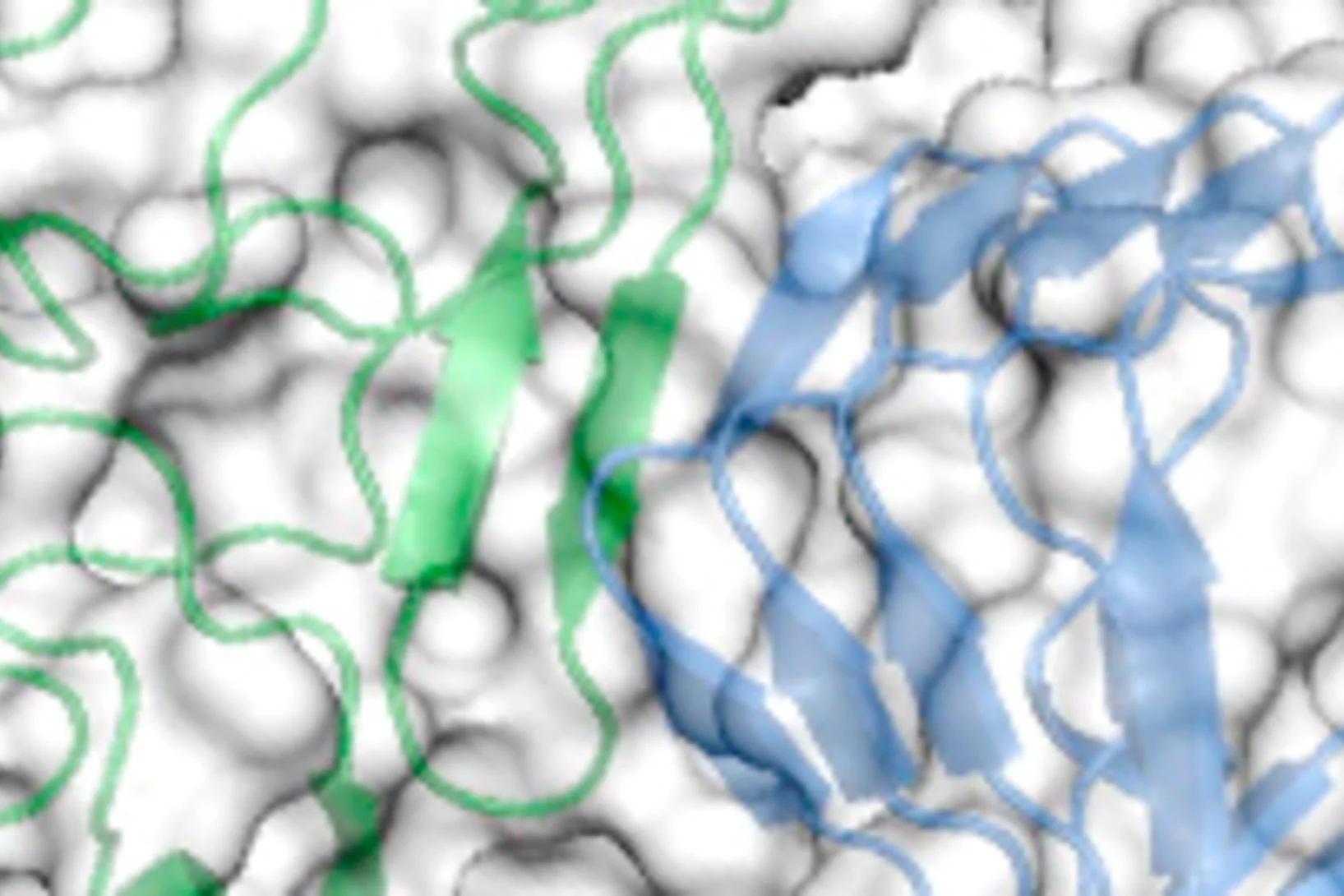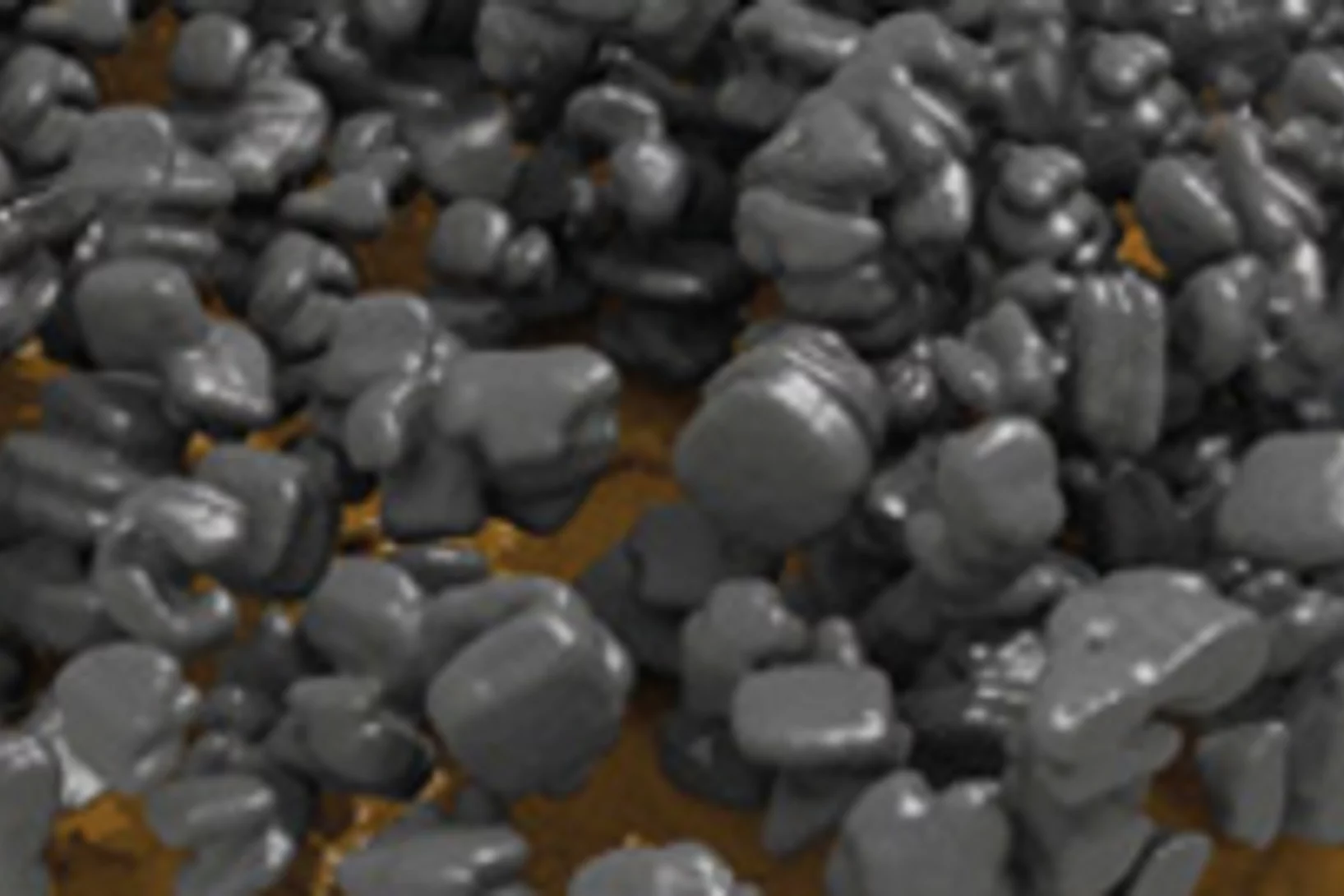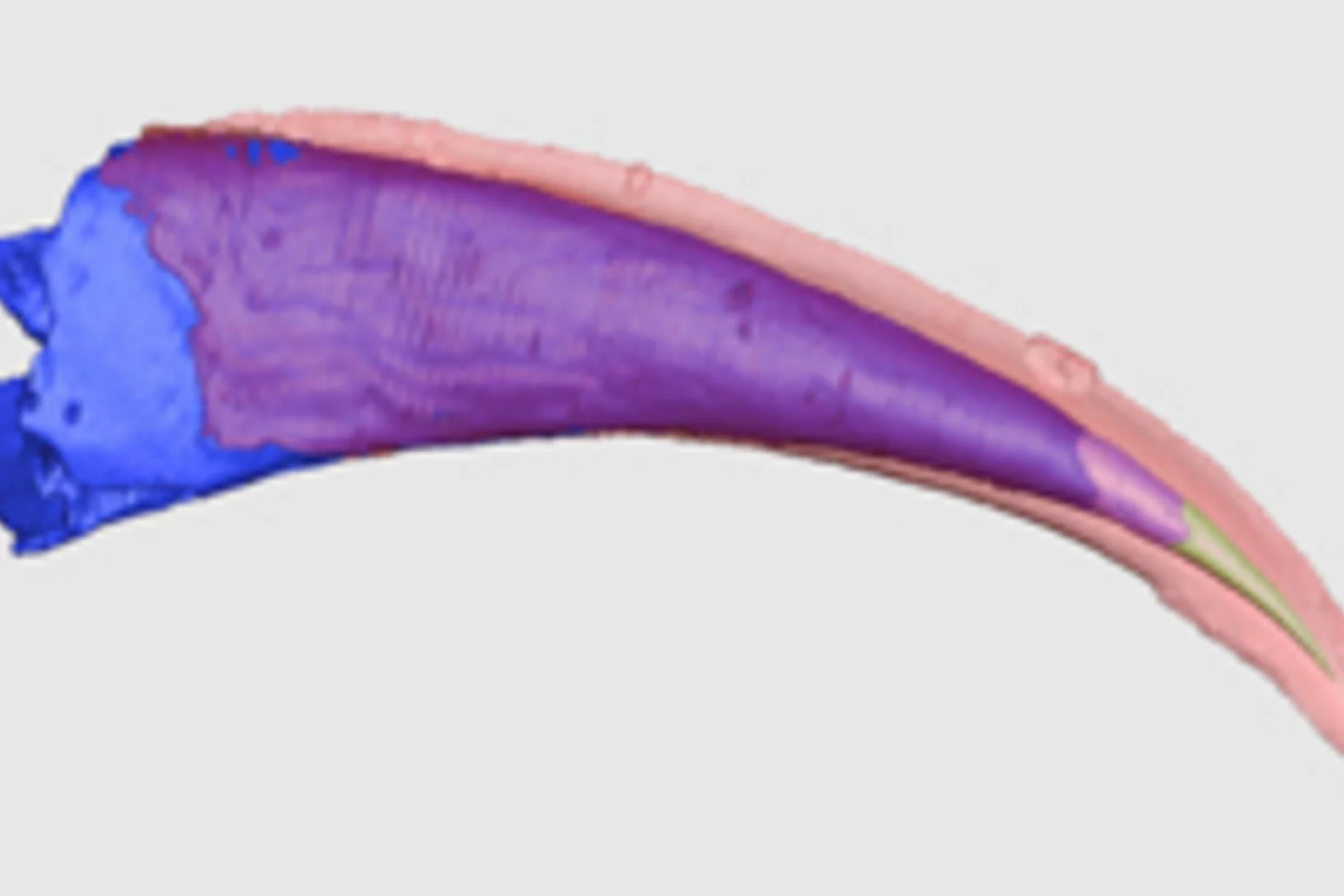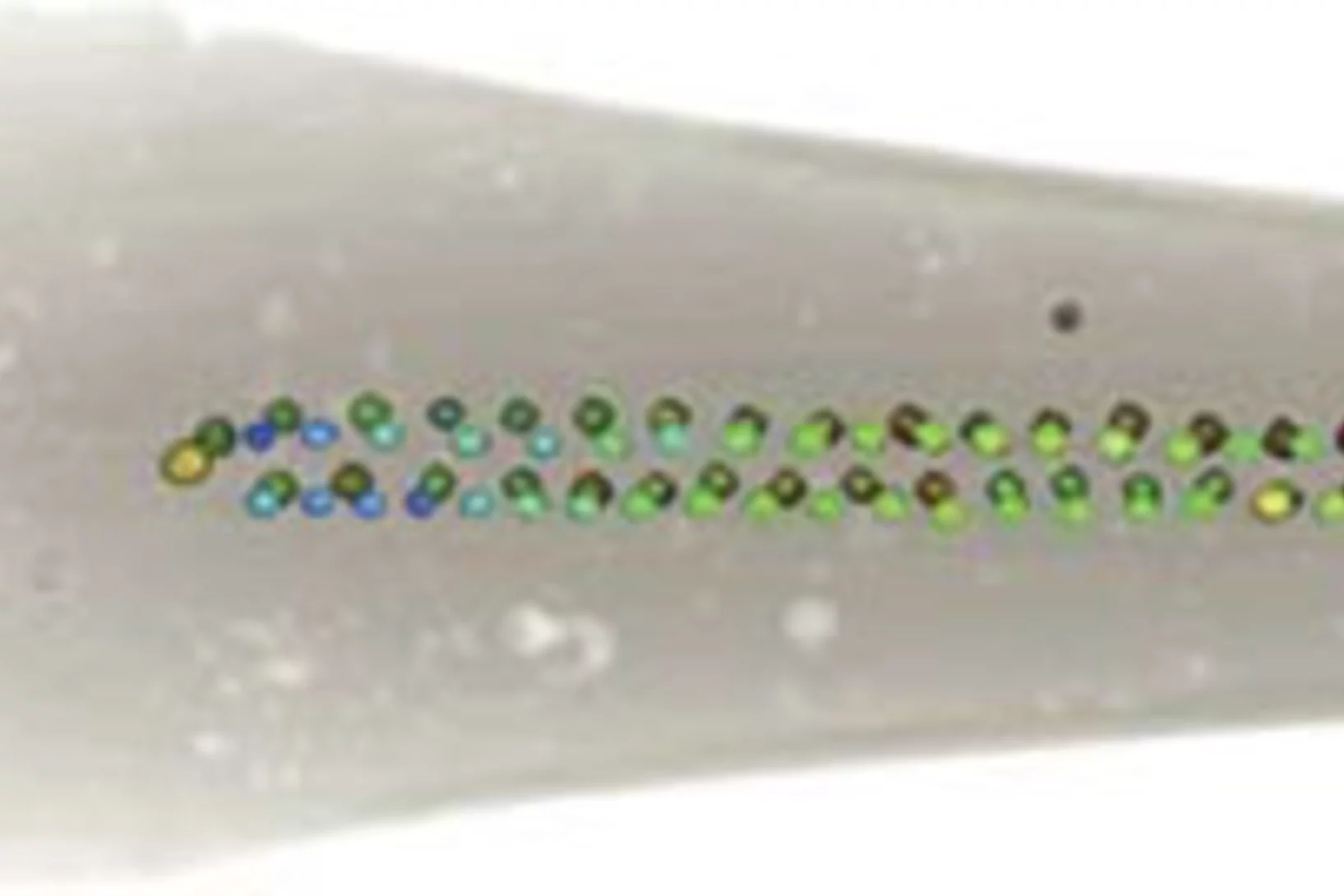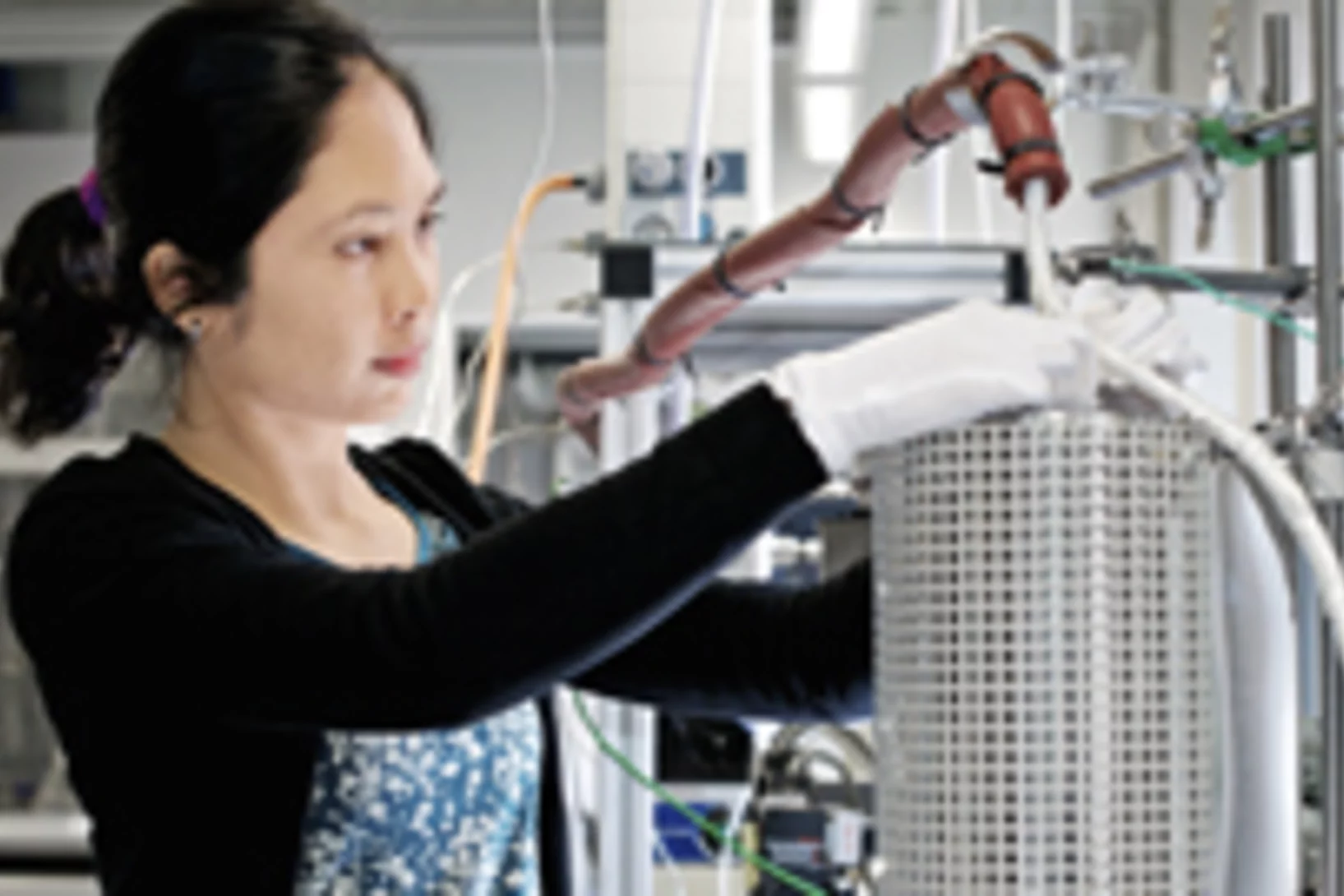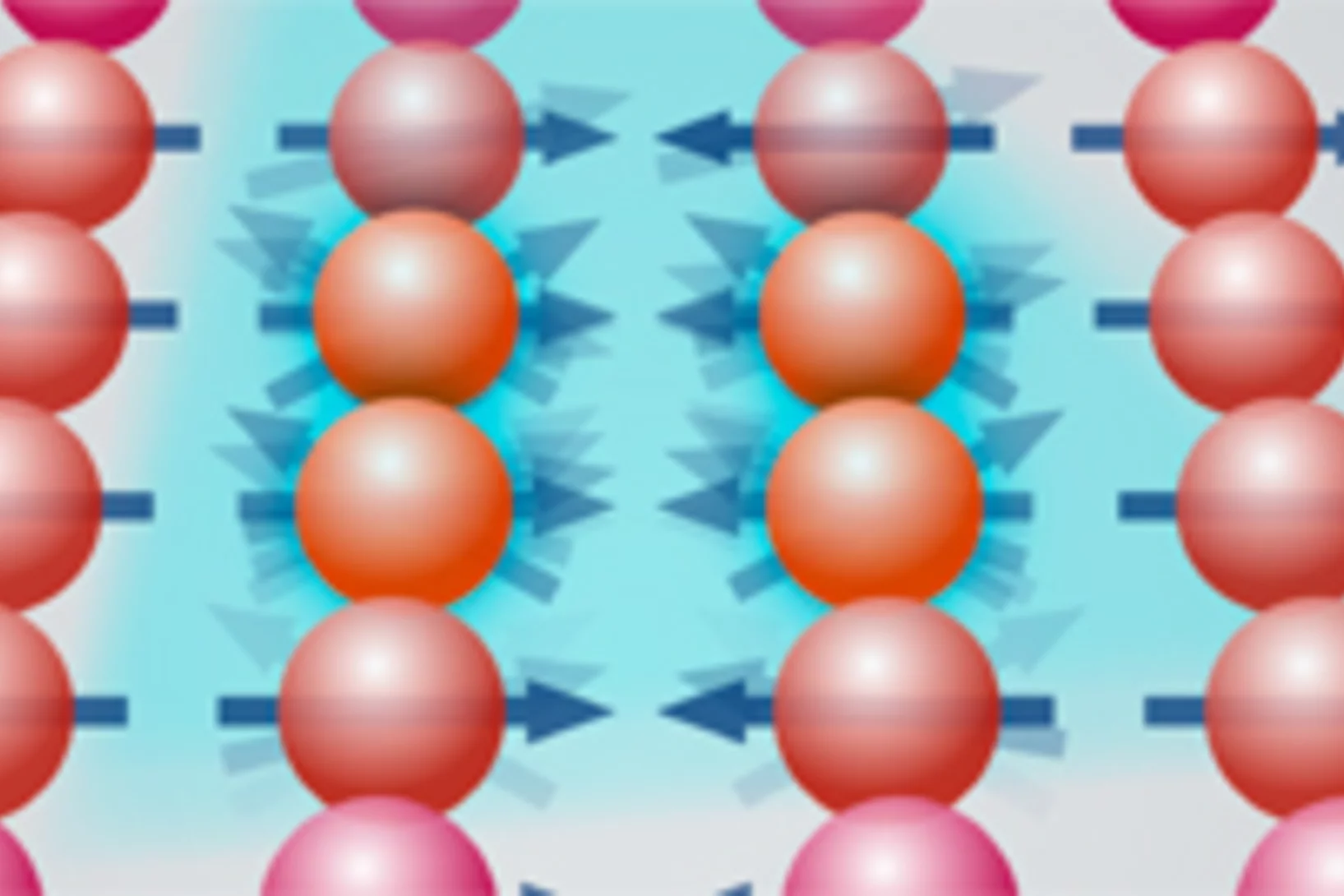SLS
Wie Botox an Nervenzellen bindet
Botox ist ein hochgefährliches Gift, das Lähmungen verursacht. In der Kosmetik wird es zur zeitweiligen Beseitigung von Falten und in der Medizin etwa als Mittel gegen Migräne oder zur Korrektur von Strabismus (Schielen) eingesetzt. Ein Forschungsteam hat nun bestimmt, wie das Toxinmolekül an die Nervenzelle bindet, deren Aktivität vom Gift blockiert wird. Die Ergebnisse können nützlich für die Entwicklung verbesserter Medikamente sein, bei denen die Gefahr einer Überdosierung geringer ist als bisher.
Elektronen mit „gespaltener Persönlichkeit“
Im supraleitenden Material La1.77Sr0.23CuO4 verhält sich oberhalb der Übergangstemperatur ein Teil der Elektronen wie in einem konventionellen Metall, ein anderer Teile wie in einem unkonventionellen à je nach Bewegungsrichtung. Das zeigen Untersuchungen an der SLS. Die Entdeckung dieser Anisotropie liefert einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Hochtemperatursupraleitung. Ausserdem wird man diesen Effekt in zukünftigen Experimenten und Theorien berücksichtigen müssen.
PSI-Forscherin Helena Van Swygenhoven erhält angesehene Europäische Förderung (ERC Grant)
Helena Van Swygenhoven, Werkstoffforscherin am Paul Scherrer Institut und Professorin an der ETH Lausanne (EPFL), erhält einen ERC Advanced Grant. Diese angesehene Förderung des Europäischen Forschungsrates in Höhe von 2,5 Millionen Euro wird es ihr ermöglichen, das neues Forschungsprojekt MULTIAX zu begründen. In diesem Projekt wird sie Vorgänge bei der Verformung von metallischen Werkstoffen untersuchen, die zum Beispiel für die Herstellungsprozesse von Autoteilen wichtig sind. Zusätzlich werden in dem Projekt neuartige Verfahren zur Untersuchung von Werkstoffen entwickelt, die dann auch anderen Forschenden zur Verfügung stehen werden.
Mit Röntgenstrahlen der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus auf der Spur
Mithilfe von Röntgen-Tomographie haben Forschende die Vorgänge in Materialien von Batterie-Elektroden detailliert untersuchen können. Anhand hochaufgelöster 3D-Filme zeigen sie auf, weshalb die Lebensdauer der Energiespeicher begrenzt ist.
Die Ursprünge der ersten Fische mit Zähnen
Mit Hilfe von Röntgenlicht aus der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI ist es Paläontologen der Universität Bristol gelungen, ein Rätsel um den Ursprung der ersten Wirbeltiere mit harten Körperteilen zu lösen. Sie haben gezeigt, dass die Zähne altertümlicher Fische (der sogenannten Conodonten) unabhängig von den Zähnen und Kiefern heutiger Wirbeltiere entstanden sind. Die Zähne dieser Wirbeltiere haben sich vielmehr aus einem Panzer entwickelt, der dem Schutz vor den Conodonten, den ersten Raubtieren, diente.
Neutronen und Synchrotronlicht helfen bronzezeitliche Arbeitstechniken zu entschlüsseln
Untersuchungen am PSI haben es möglich gemacht, zu bestimmen, wie ein einzigartiges bronzezeitliches Beil hergestellt worden ist. Zu verdanken ist das dem Verfahren der Neutronentomografie, mit der man ein genaues dreidimensionales Abbild des Inneren eines Gegenstandes erzeugen kann. Seit einem Jahrzehnt kooperiert das PSI erfolgreich mit verschiedenen Museen und archäologischen Institutionen im In- und Ausland. Es ist ein deutliches Zeichen der etablierten Kooperation, dass der 18. Internationale Kongress über Antike Bronzen, der vom 3. - 7. September 2013 an der Universität Zürich stattfindet, auch einen Tag am PSI tagt.
Winzige Magnete als Modellsystem
Wissenschaftler untersuchen an Nano-Stäbchen, wie sich Materie ordnetUm die magnetischen Wechselwirkungen zwischen Atomen sichtbar zu machen, haben Forschende am PSI ein Modellsystem entwickelt. Es ist so gross, dass es sich bequem unter einem Röntgenmikroskop beobachten lässt und imitiert doch die kleinsten Bewegungen in der Natur. Das Modell: Ringe aus jeweils sechs nanometergrossen magnetischen Stäbchen. Bei Raumtemperatur schwanken die Magnetisierungsrichtungen der einzelnen kleinen Stäbchen ständig und auf natürliche Weise. Die magnetischen Wechselwirkungen zwischen den Stäbchen konnten die Wissenschaftler deshalb in Echtzeit beobachten.
Von Methan zu Methanol- oder wie man die Fackeln der Verschwendung löscht
In aus dem Weltraum aufgenommenen Nachtfotos sind die grossen Metropolen der Erde an der Flut ihrer öffentlichen Beleuchtung leicht zu erkennen. Wohl nur das geübte Auge kann da jedoch nebst New York oder Tokyo auch den Standort mancher Erdölförderbrunnen ausmachen. Das Licht stammt in diesem Fall primär aus der Verbrennung von Methan. Diese Verschwendung eines energiereichen Gases hat gravierende ökonomische und ökologische Folgen. PSI-Forschende sind auf der Suche nach einer Lösung: die Umwandlung von Methan zum flüssigen Energieträger Methanol
Supraleiter überraschen mit verblüffenden Eigenschaften
Wissenschaftler des Paul Scherrer Instituts haben zusammen mit chinesischen und deutschen Forscherkollegen neue Erkenntnisse zu einer Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern gewonnen. Die experimentellen Ergebnisse aus der Grundlagenforschung deuten darauf hin, dass magnetische Wechselwirkungen für das Phänomen der Hochtemperatur-Supraleitung von zentraler Bedeutung sind. Dieses Wissen könnte in Zukunft dazu beitragen, Supraleiter mit besseren technischen Eigenschaften zu entwickeln.
Fluktuationen mit Röntgenmikroskop sichtbar gemacht
Mit Röntgenstrahlen kann die Nanostruktur von so unterschiedlichen Objekten untersucht werden, wie einzelne Zellen oder magnetische Datenträger. Hochauflösende Bilder sind jedoch nur möglich, wenn sowohl Mikroskop als auch das Untersuchungsobjekt extrem stabil sind. Forscher der TU München des PSI zeigten nun, wie man diese Bedingungen lockern kann, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Auch hochdynamische Systeme, wie z.B. magnetische Fluktuationen, die die Lebensdauer von Daten auf Festplatten einschränken, können mit der neuen Methodik untersucht werden.