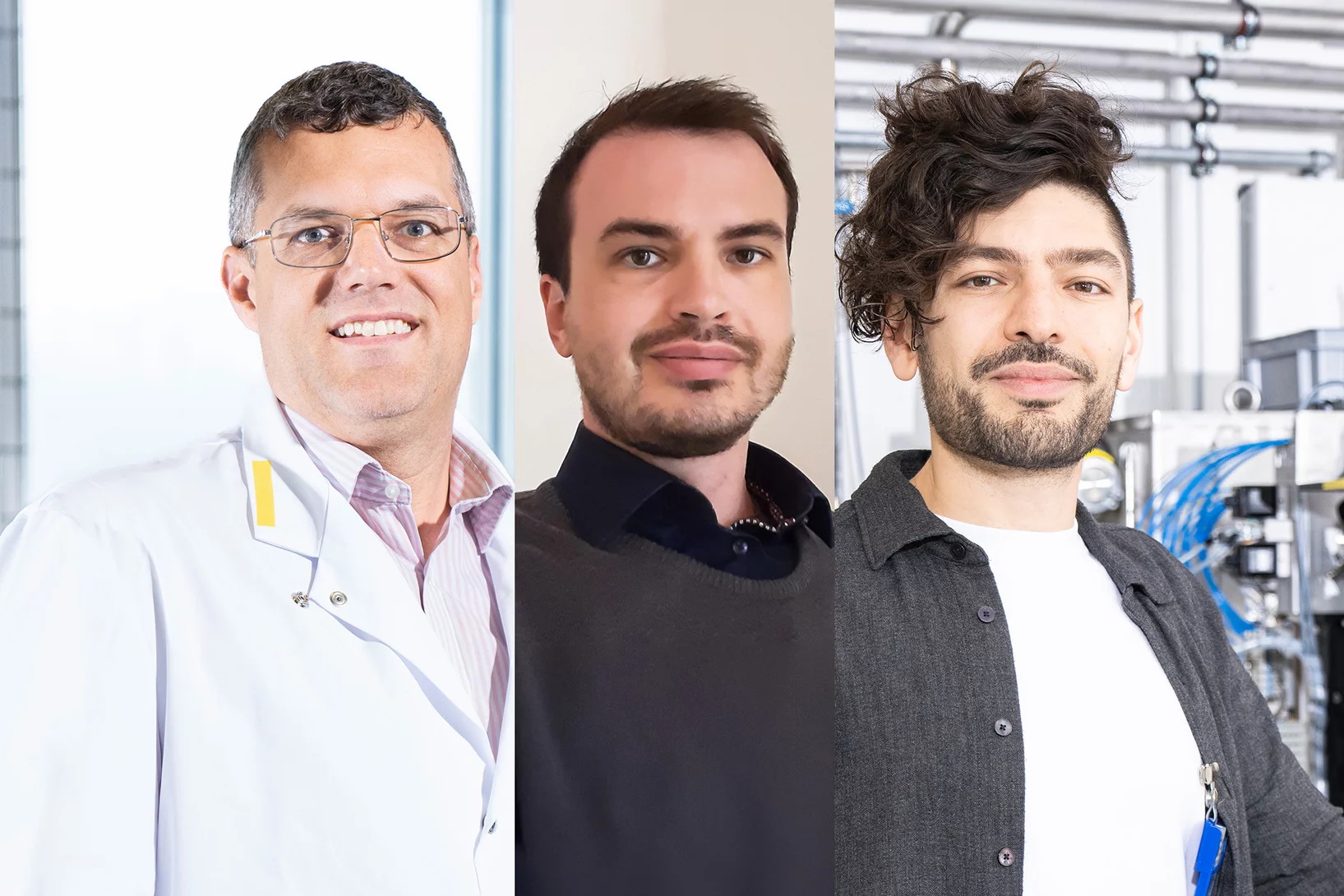«Beton beim Hartwerden zuzuschauen ist spannender, als man denken mag»
Grau, hart, langweilig – für die meisten Menschen beschreiben diese drei Wörter das Material Beton ausreichend. John Provis sieht das anders. Der Wissenschaftler am Paul Scherrer Institut PSI hat sein Forscherleben dem allgegenwärtigen und wirtschaftlich bedeutsamen Baustoff verschrieben: Er will die Geheimnisse des Betons ergründen.

Beton, wie in vielen Schweizer Brücken verbaut, ist das Spezialgebiet von Materialforscher John Provis. Am Paul Scherrer Institut PSI erforscht er den weitverbreiteten Baustoff, um ihn zu verbessern und nachhaltiger zu machen. © Paul Scherrer Institut PSI/Mahir Dzambegovic
Für einen Betonforscher sei die Schweiz der ideale Ort, sagt John Provis. Aufgewachsen ist er im australischen Melbourne – seit 2023 arbeitet er am Paul Scherrer Institut PSI. «Nicht nur hat die Schweiz eine internationale Führungsposition in der Zementforschung. Sie ist zudem dafür bekannt, viel und qualitativ hochwertigen Beton zu verbauen. Wenn man die Gebäude hier anschaut, sieht man das.»
Am PSI ergründet John Provis den Baustoff auf vielen verschiedenen Skalen: «Es kann vorkommen, dass ich eine zehn Mikrometer kleine Betonprobe untersuche und in der nächsten Woche einen drei mal drei Meter grossen Betonblock», erzählt er. Die einzelnen Puzzlestücke, sprich Untersuchungsergebnisse, setzt er dann zusammen, um das Material von Grund auf besser zu verstehen.
Zusammenspiel an den Grenzschichten
«Ich schaue Beton buchstäblich beim Hartwerden zu», witzelt John Provis. Gerne spielt der 45-jährige Forscher mit der Ironie, wie langweilig das klingt. Für ihn nämlich ist es hoch spannend.
Beton entsteht durch das Mischen von Zementpulver, Gesteinskörnern – wie Sand, Kies oder Splitt – und Wasser, zusammen mit Zugaben wie Mineralpulver, Aschen und speziellen Polymeren. Beim Aushärten bildet sich die steinähnliche Substanz, die die Bauindustrie so schätzt. In der Schweiz werden jedes Jahr rund sechzehn Millionen Kubikmeter Beton verbaut; damit ist er der volumenmässig meist eingesetzte Baustoff des Landes.
John Provis interessiert sich vor allem dafür, wie die einzelnen Zement-, Gesteins- und anderen Mineralpulverkörner sowie das Wasser aufeinandertreffen. Es sind Bestandteile ganz unterschiedlicher Grösse und ihr komplexes Zusammenspiel ist noch weitgehend unverstanden. Um sie zu erforschen, erhielt Provis vor Kurzem einen der prestigeträchtigen Advanced Grant des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) über 2,14 Millionen Schweizer Franken für fünf Jahre.
Mikroskopie, Röntgenstrahltechniken, Spektroskopie, Neutronen- und Synchrotronstrahlung – Provis nutzt viele verschiedene Techniken, um in Beton hineinzuschauen. Am PSI mit seinen vielseitigen Grossforschungsanlagen ist er also bestens aufgehoben.
«Grosses mit Chemie»
In den Regalen in John Provis’ Büro stapeln sich unzählige Bücher und Fachzeitschriften rund um Beton und Zement. Dazwischen lagert der Forscher für ihn besonders interessante Exemplare der Materialien in Form von Würfeln und handgrossen Blöcken.
Studiert hat John Provis Chemieingenieurwesen; nur durch einen Zufall landete er in der Beton- und Zementforschung: «Ich wollte immer grosse Dinge mit Chemie machen», erzählt er. Dies schien ihm in der Petrochemie ursprünglich am besten möglich. Doch als er für seine Semesterferien in Melbourne kurzfristig eine Forschungsassistentenstelle suchte, landete er in einer Gruppe, die Zement als Barriere gegen umweltschädliche Substanzen erforschte. Auch seine Doktorarbeit widmete er dann der Zementforschung und wurde so Teil einer Branche, die weltweit zu den grössten Industriezweigen überhaupt zählt. «Grosses mit Chemie» kann er hier tatsächlich erreichen.
Von Australien nach Europa
Im Jahr 2012, nach Doktorarbeit und Postdoc, verliess John Provis Down Under und zog mit seiner Ehefrau – jetzt ebenfalls Professorin für nachhaltige Baumaterialien − nach England. Auf einer Professorenstelle an der Universität Sheffield arbeitete er unter anderem an nachhaltigem Beton. Denn die Herstellung von Zement ist eine der grössten Verursacherinnen von Treibhausgasen weltweit. «Alles, was wir tun können, um den Anteil des Zements im Beton zu senken, ist eine gute Sache.»
Mit seinen Studierenden macht er gerne informelle Führungen durch Städte und durch Universitäten, um ihnen die verschiedenen Arten zu zeigen, wie Beton versagen kann. «In der Art: Hier hängt ein Stück Stahl raus, weil der Beton nicht dick genug war, und jetzt rostet der Stahl. Oder hier ist der Beton an der Oberfläche zerbröselt, vermutlich aufgrund gefrierenden Wassers.»
In der Schweiz angekommen
John Provis liebt es, ein so komplexes und doch alltägliches Material zu erforschen. «Beton ist im Grunde ein Hochleistungswerkstoff, aber die meisten Menschen, die mit ihm arbeiten, sind keine hoch spezialisierten Betoningenieurinnen oder -ingenieure», erzählt er. «Viele Leute mischen sich ihren Beton mit Schubkarre, Schaufel und Gartenschlauch zusammen, um beispielsweise einen Zaunpfahl im eigenen Garten zu verankern.» Und das klappe auch meistens ganz gut. «Beton vergibt viel: Selbst wenn er falsch angerührt wird, entsteht noch ein Material, das sich ganz gut verwenden lässt.»
Seit knapp zwei Jahren forscht John Provis nun am PSI in Villigen. Zement, erklärt John Provis, ist nicht nur eine Zutat für den Baustoff Beton – er wird auch dazu verwendet, radioaktiven Abfall sicher einzuschliessen und zu verwahren. Daher ist sein Team am Labor für Endlagersicherheit am Zentrum für Nukleare Technologien und Wissenschaften des PSI angesiedelt.
In der Schweiz fühlt Provis sich wohl. Fast schon ehrfürchtig erzählt er, dass in seinem Wohnort Würenlos eine unscheinbare Pferdetränke stehe, die aus den 1740er-Jahren datiert. «Das war noch, bevor die ersten europäischen Kolonisten nach Australien kamen!» Auch die Nachbarländer der Schweiz erkundet er gerne: «Es gibt in Europa so viel kulturellen Reichtum, einhergehend mit Geschichte, Traditionen und Sprachvielfalt. Ich geniesse es sehr, ein Teil davon zu sein und darüber zu lernen.»
Dass er in der Schweiz seinen Studierenden keine anschaulichen Ausflüge zu schlechtem Beton bieten kann, nimmt Provis gerne in Kauf.
- Zu den ersten Betonbauern der Geschichte zählen die Römer. Die Kuppel des Pantheons in Rom ist bis heute die grösste Struktur dieser Art, die jemals aus Beton ohne Stahlverstärkung gebaut wurde. Marcus Vitruvius Pollio, kurz Vitruv, schrieb um 30 vor Christus die «Zehn Bücher über Architektur» und beschreibt darin auch die Betonformulierungen, die im Römischen Reich Anwendung fanden.
- Die Herstellung von Zement ist klimaschädlich: Die sechs Zementwerke der Schweiz sind für rund fünf Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bei der Zementherstellung wird Kalkstein auf rund 1400 Grad Celsius erhitzt und setzt dabei Kohlendioxid frei. Ausserdem verbraucht der Vorgang grosse Mengen Energie.
- Beim Anrühren von Beton ist das Durchmischen zwar leichter, wenn man mehr Wasser beimischt. Bei zu viel Wasser besteht aber die Gefahr, dass sich Zementpaste und gröbere Gesteinskörner vor dem Hartwerden des Betons entmischen. Beispielsweise können grössere Steine zu Boden sinken, es entstehen sogenannte Kiesnester und damit Beton schlechter Qualität.
- Wird Beton gegossen, werden oft Gussformen aus Holz oder Stahl verwendet. Auf dem fertigen Beton sieht man daher den Abdruck der Formen, beispielsweise die Maserung der hölzernen Gussform.
- Anders als Asphalt erhärtet Beton schneller, wenn er warm wird. Das kann zum Problem werden, wenn ein Fahrmischer mit noch flüssigem Beton bei heissem Wetter im Verkehr stecken bleibt. Ein Sack Zucker kann helfen: In den flüssigen Beton geschüttet vergiftet er die chemische Reaktion und hindert den Beton am Aushärten. Der Beton muss hinterher zwar verworfen werden, aber der Fahrmischer ist gerettet.
Kontakt
Dr. John Provis
PSI Center for Nuclear Engineering and Sciences
Paul Scherrer Institut PSI
+41 56 310 41 35
john.provis@psi.ch
[Englisch]