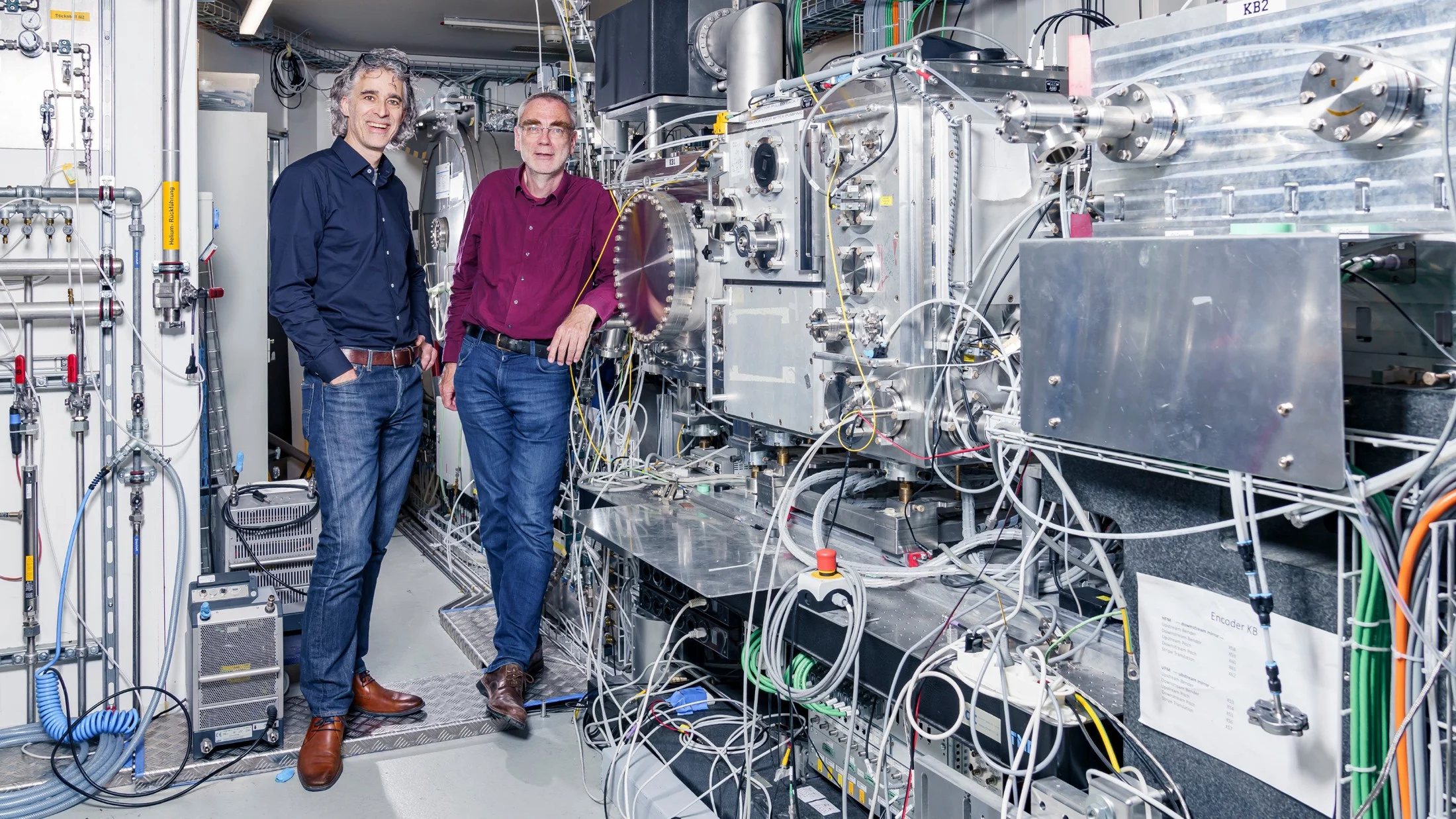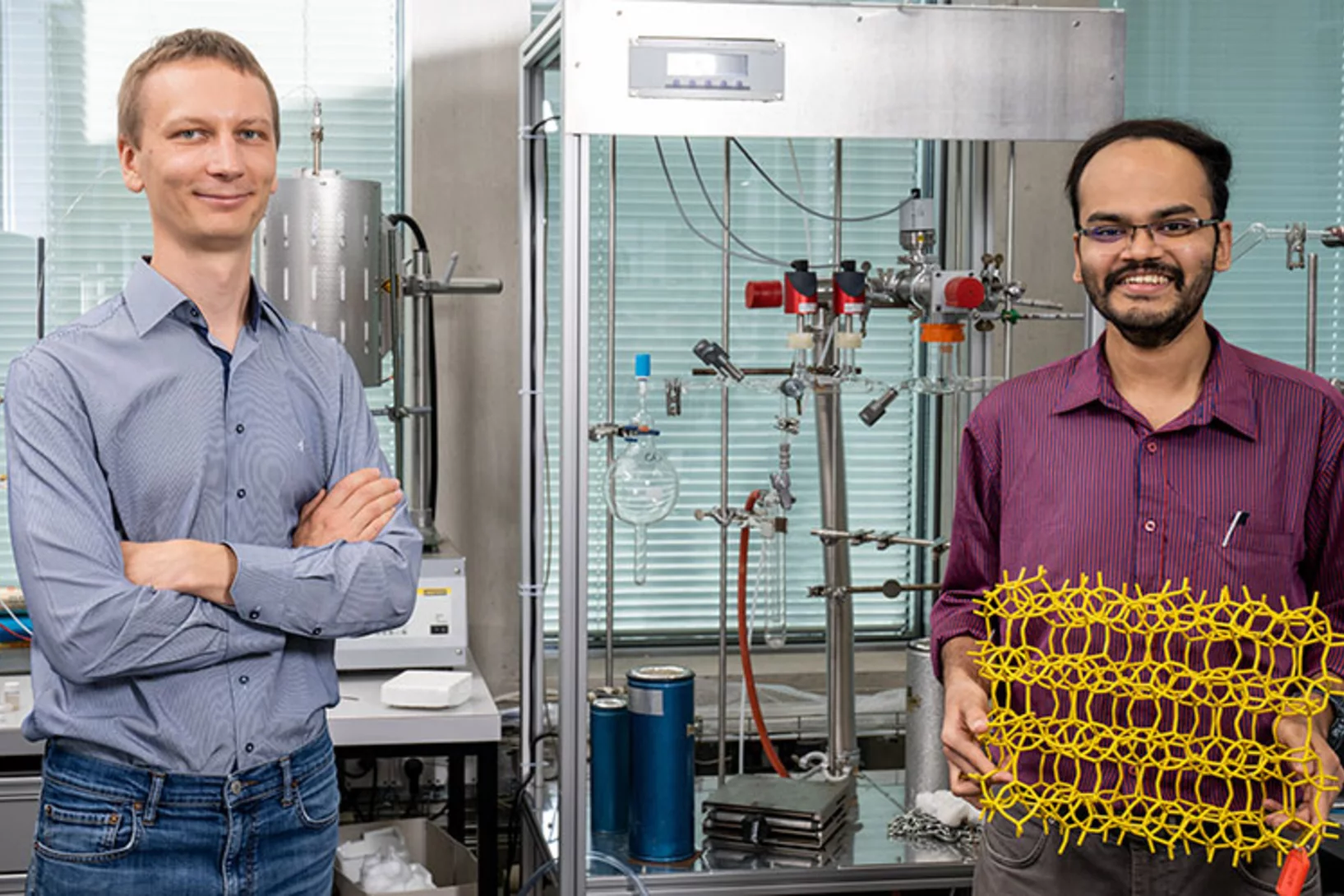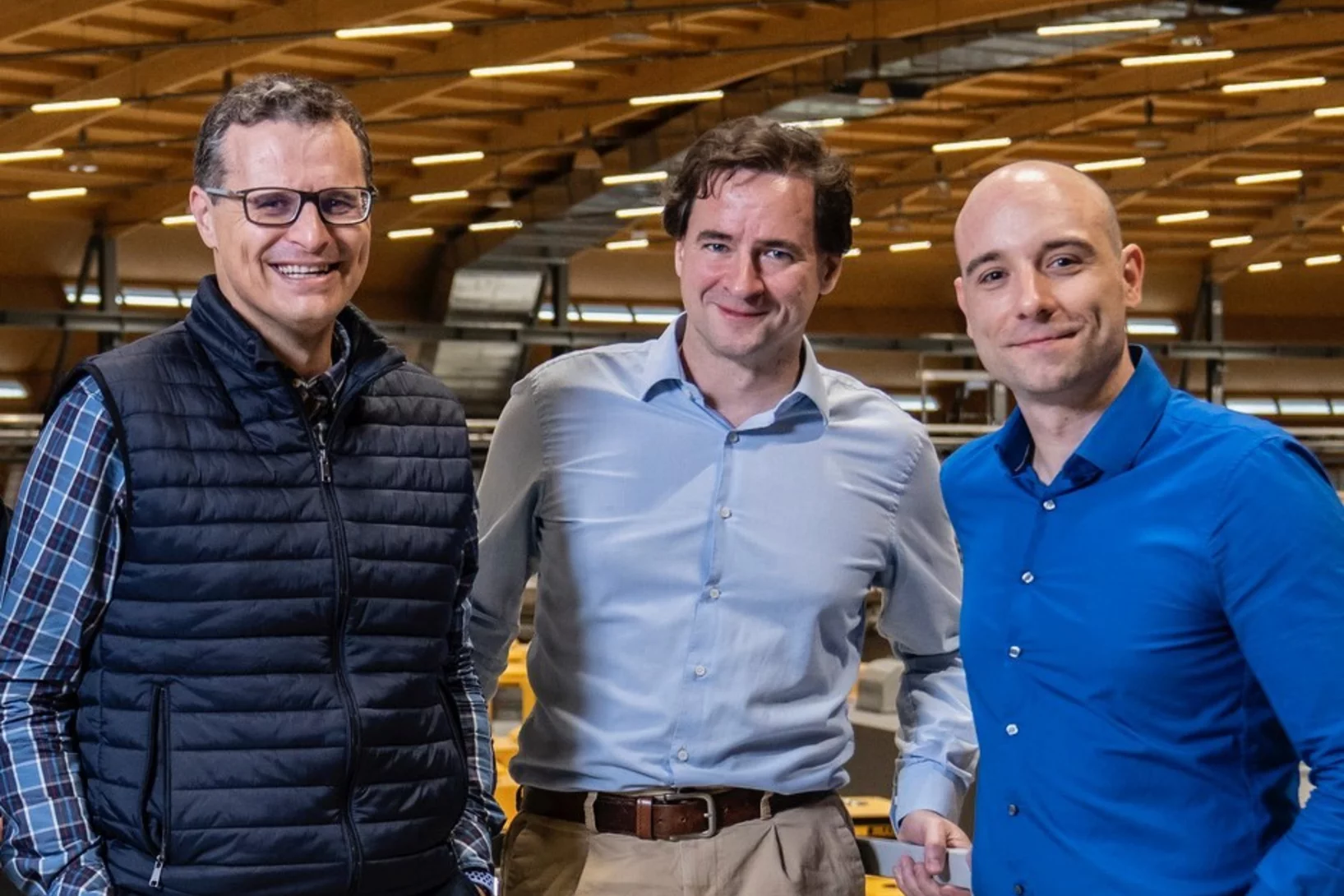Zeolithe sind hochporöse Substanzen, die in der chemischen Industrie zahlreiche Reaktionen möglich machen. PSI-Forschenden ist es in Zusammenarbeit mit dem J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prag jetzt erstmals gelungen, die Lage der Aluminiumatome im Zeolithgitter genau zu bestimmen − ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu massgeschneiderten Katalysatoren. Die Studie ist nun im Fachjournal Science erschienen.
In Katzenstreu binden sie unangenehme Gerüche; in Waschmittel machen sie das Wasser weicher und schützen so die Waschmaschine; und in Raffinerien helfen sie bei der Herstellung von Benzin − Zeolithe sind vielfältig eingesetzte Materialien. Sie begegnen uns im Alltag und sind in der Industrie die meistbenutzten Katalysatoren, um chemische Reaktionen zu erleichtern.
Ihre vielen nützlichen Eigenschaften rühren von ihrem porösen, gitterartigen Aufbau her: Silizium- und Aluminiumatome formen, über Sauerstoffatome verbunden, kristalline Gerüste mit vielen kleinen Poren und Kanälen. Darin können Zeolithe Moleküle aus Gasen oder Flüssigkeiten einfangen, sie festhalten und dabei helfen, sie zu anderen Molekülen umzuwandeln. Doch erst jetzt konnten PSI-Forschende ein genaueres Bild einer Zeolithstruktur zeichnen: Sie machten sichtbar, wo im Gitter die Aluminiumatome sitzen, welche die chemischen Reaktionen in Gang setzen.
«Zeolithe sind extrem wichtige Materialien, aber trotzdem verstehen wir noch zu wenig, wie genau sie funktionieren», sagt Jeroen van Bokhoven vom Zentrum für Energie- und Umweltwissenschaften am PSI. Bisherige Methoden konnten zwar die Lage der Gerüstatome ermitteln, aber Aluminium liess sich dabei nicht von Silizium unterscheiden. Die Aluminiumatome spielen jedoch eine besonders wichtige Rolle: Sie bilden die katalytischen Zentren, sorgen also dafür, dass bestimmte Reaktionen ablaufen können. Daher sind Forschende gerade an ihnen besonders interessiert.
Die genaue Position der Aluminiumatome entscheidet darüber, wie gut und für welche chemischen Reaktionen das jeweilige Zeolith als Katalysator fungiert. Denn für unterschiedliche Reaktionen sind unterschiedliche Zeolithstrukturen im Einsatz. Die PSI-Forschenden untersuchten mit ihrer Methode den Zeolith ZSM-5, einen besonders wichtigen Katalysator in der Industrie, der einen aussergewöhnlich komplexen Aufbau hat. «Wir dachten uns: Wenn wir das mit ZSM-5 hinbekommen, sind auch die anderen Zeolithe kein Problem», sagt Jeroen van Bokhoven.

Erstautor Przemyslaw Rzepka entwickelte als Postdoc im Team von Jeroen van Bokhoven am PSI eine neue Methode, um Aluminium- und Siliziumatome in Zeolithen unterscheiden zu können. Er ist jetzt Wissenschaftler am J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prag. © Przemyslaw Rzepka
Die SLS als grosses Mikroskop
An der Frage, wo genau die Aluminiumatome in der Zeolithstruktur sitzen, biss sich die Wissenschaft lange die Zähne aus. «Die neue Methode, die wir entwickelt haben, löst ein Problem, das bisher unlösbar schien», sagt Przemyslaw Rzepka, Erstautor der Studie. Er arbeitete ehemals als Postdoktorand bei Jeroen van Bokhoven am PSI und ist jetzt Wissenschaftler am J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prag.
Bisher schaute die Wissenschaft mit gewöhnlichem Röntgenlicht ins Innere der Zeolithe, um den Aufbau der Poren und Kanäle zu verstehen. Die Strahlung wird an den Atomen gestreut und aus dem Muster, das dabei entsteht, lässt sich auf den dreidimensionalen Aufbau des Materials rückschliessen. Das Problem: Da die Elemente Silizium und Aluminium im Periodensystem direkt nebeneinanderliegen, sehen sie in Experimenten mit gewöhnlichem Röntgenlicht quasi gleich aus. Andere, spektroskopische Methoden hingegen basieren darauf, dass ein Material Strahlung absorbiert oder diese beeinflusst. Da Strahlung von Aluminium anders absorbiert wird als von Silizium, lassen sich die beiden Atomsorten so zwar unterscheiden – diese Methoden ermöglichen es allerdings nicht, Positionen im Raum zu bestimmen, sondern nur die Anzahl und Art der Atome in einem Material.
Die Lösung der PSI-Forschenden: eine Kombination aus beiden Techniken. Sie bestrahlten die Materialien an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS mit weichem Röntgenlicht, das also eine vergleichsweise niedrige Energie hat. «Das Muster, das beim Streuen des Röntgenlichts durch das Material entsteht, verrät uns, wo die Atome sind. Wir schauen uns dann diese Positionen mit spektroskopischen Methoden an, um zu identifizieren, welche Art von Atom es ist», erklärt Przemyslaw Rzepka.
Diese trickreiche Kombination wurde möglich durch das einzigartige Röntgendiffraktometer für weiche Röntgenstrahlen an der Phoenix-Strahllinie der SLS. So konnten die Forschenden erstmals einen Unterschied zwischen Silizium- und Aluminiumatomen sehen und die genaue Lage der katalytischen Zentren ermitteln, an denen die Reaktion stattfindet.
In über zehn Jahren zum Ergebnis
Begonnen haben die PSI-Forschenden mit ihrem Projekt im Jahr 2014 – vor über einem Jahrzehnt also. «Es waren einige Jahre harter Arbeit, um beide Techniken miteinander zu kombinieren und die Strahllinie der SLS an diese Bedürfnisse anzupassen», erzählt Przemyslaw Rzepka. «Möglich wurde uns das nur durch die enge Zusammenarbeit mit den Forschenden an der Strahllinie.»
Einer von ihnen ist Thomas Huthwelker, Wissenschaftler an der SLS und Co-Autor der Studie. «Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung hier an der SLS mit ihrer soliden und breit gefächerten Forschungsinfrastruktur sind wir in der Lage, völlig neue, manchmal riskante, aber am Ende sehr lohnende Projekte zu realisieren», sagt er.
Nachdem es nun möglich ist, die jeweilige Lage der Aluminiumatome in verschiedenen Zeolithen zu bestimmen, wollen die Forschenden untersuchen, wie dies die Leistung des Katalysators beeinflusst. Wo genau müssen die Aluminiumatome sitzen, damit eine bestimmte Reaktion abläuft? Fernziel ist es, Katalysatoren für bestimmte Reaktionen auf Mass zu schneidern. «Dafür müssen wir die Zeolithe genauer verstehen und ihren Aufbau kennen. Wir sind jetzt auf einem guten Weg dorthin», sagt Jeroen van Bokhoven. Sogar andere Materialien als Zeolithe liessen sich mit der neuen Methode untersuchen. «Es fängt jetzt erst richtig an», freut er sich. «Die nächsten zehn Jahre werden extrem spannend.»
Kontakt
Originalveröffentlichung
-
Rzepka P, Huthwelker T, Dedecek J, Tabor E, Bernauer M, Sklenak S, et al.
Aluminum distribution and active site locations in the structures of zeolite ZSM-5 catalysts
Science. 2025; 388(6745): 423-428. https://doi.org/10.1126/science.ads7290
DORA PSI