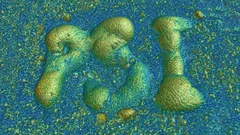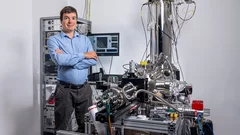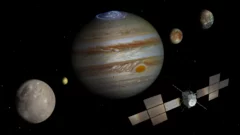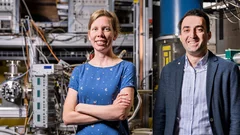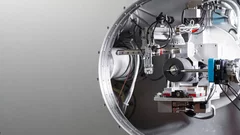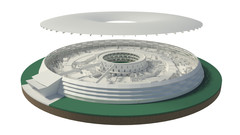Zukunftstechnologien
Die vielfältigen Eigenschaften von Materialien werden bestimmt durch die Art der Atome, aus denen sie bestehen, wie diese angeordnet sind und wie sie sich bewegen können. Auf dem Gebiet Zukunftstechnologien wollen die Forschenden des Paul Scherrer Instituts diesen Zusammenhang zwischen innerem Aufbau und beobachtbaren Eigenschaften für unterschiedliche Stoffe aufklären. Mit dem daraus gewonnenen Wissen wollen sie Grundlagen für neue Anwendungen – sei es in der Medizin, der Informationstechnologie, der Energiegewinnung und -speicherung – oder für neue Produktionsverfahren der Industrie schaffen.
Mehr dazu unter Überblick Zukunftstechnologien
Switzerland Innovation Park Innovaare feiert Eröffnung
Nach vierjähriger Bauzeit ist neben dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen (AG) ein moderner Innovationspark mit 23 000 m2 Reinräumen, Labors, Präzisionswerkstätten, Büros und Meetingräumen entstanden.
Grundlegend anders
Künstliche Intelligenz hilft dabei, unvorstellbar grosse Datenmengen effizient auszuwerten und das volle Potenzial der Grossforschungsanlagen auszuschöpfen.
Musik mit Röntgenlicht retten
Die SLS spielt den «King of the Blues» – B.B. King! In Zusammenarbeit mit dem «Montreux Jazz Digital Project» werden am PSI historische Tonbänder digitalisiert.
Eine mögliche Abkürzung
Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gehören heute zum Handwerkszeug der meisten Forschenden am PSI. Diese Methoden verändern die Wissenschaft teilweise grundlegend.
3-D-Einblicke in neuartiges Fertigungsverfahren
Mit 3-D-Druck komplexe Formen herstellen
«Molekülketten könnten interessant sein für die Elektronik der Zukunft»
Christian Wäckerlin spricht über Grundlagenforschung an aussergewöhnlichen Nanodrähten – und über mögliche Anwendungen.
Jupiter-Mission soll lebensfreundliche Bedingungen erkunden
Ganymed, Kallisto und Europa: Das sind Jupiters eisige Monde und das Reiseziel der kommenden ESA-Mission. Mit an Bord: ein Hightech-Detektor vom PSI.
Hightech-Unternehmen VDL ETG wird Nachbar des PSI
Das niederländische Unternehmen VDL ETG hat einen Mietvertrag mit dem Park Innovaare unterzeichnet.
Swiss PIC unterstützt die Schweizer Photonik-Industrie
Das Technologietransferzentrum Swiss PIC wird im Park Innovaare angesiedelt sein.
Auto-Bremsen weiter optimieren
Mit Neutronen blicken Forschende des PSI und ANAXAM ins Innere einer Bremse und spüren Potenziale zur Senkung von CO2-Emissionen auf.
3,1 Millionen Förderung für neue Forschungsprojekte am PSI
Die beiden PSI-Forschenden Zurab Guguchia und Kirsten Schnorr erhalten vom Schweizerischen Nationalfonds Förderbeiträge von insgesamt 3,1 Millionen CHF für zukunftsweisende Projekte.
Neue Materialien für den Computer der Zukunft
Forschende identifizieren und untersuchen Materialverbindungen, deren spezielle Eigenschaften neuartige Mikrochips möglich machen könnten.
«Excelsus» feiert zehnjähriges Jubiläum
Das PSI-Spin-off «Excelsus Structural Solutions» führt an der SLS Messungen im Auftrag von Kunden durch.
Lösung für das Unlösbare
PSI und ETH Zürich haben den Quantum-Computing-Hub gegründet. Spitzenforschende arbeiten dort gemeinsam an Konzepten für Quantencomputer.
Herkules und Akkus durchleuchtet
Mit Myonen lassen sich können PSI-Forschende Objekte zerstörungsfrei untersuchen. Das hilft in der Archäologie und bei der Batterie-Entwicklung.
Neuartige Röntgenlinse erleichtert Blick in die Nanowelt
Erstmals gibt es nun eine achromatische Linse auch für Röntgenlicht – entwickelt am PSI.
Simulation soll bei Aufräumarbeiten in Fukushima helfen
Eine neue Simulation der gefährlichsten radioaktiven Trümmer des Kernkraftwerks Fukushima soll bei Aufräumarbeiten helfen.
Mit Topologie zu kompakteren Quantencomputern
Auf dem Weg zu besonders stabilen Quantenbits haben Forschende die Elektronenverteilung in zwei Halbleitern genau untersucht.
Millionenförderung für Hirn- und Quantenforschung
Der Europäische Forschungsrat bewilligt PSI-Projekte zur Entwicklung eines Quantencomputers und zur Hirnforschung in Höhe von 5 Millionen Euro.
Halbleiter erreichen die Quantenwelt
Mit einem Supraleiter aufgemotzt: Die Halbleitertechnologie könnte eine neue Wendung erhalten, indem Quanteneffekte in Supraleitern ausgenutzt werden.